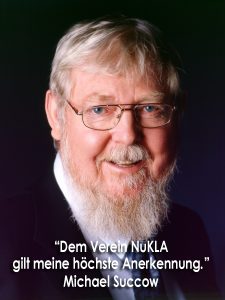Wir Menschen sind sprachliche Wesen. Unsere ganze Menschenwelt wäre ohne Sprachen nicht denkbar. Unsere Kultur wäre ohne Sprachen nicht denkbar. Wären wir als Menschen überhaupt ohne Sprachen denkbar? Könnte man ohne Sprachen überhaupt – denken?
Wir Menschen sind nicht die einzigen Wesen mit einer oder gar mehreren Sprachen. Viele Tiere kommunizieren als soziale Wesen ebenso miteinander, man liest, sie täten dies sogar sehr komplex und mit vielen Mitteln: nicht nur über Laute, sondern auch über chemische Signale, Gesten und – besonders exotisch – über Elektrizität. Und es gibt Wissenschaftler, die nachgewiesen haben, dass auch Pflanzen miteinander kommunizieren können. Aber es ist schon recht einzigartig, was wir Menschen mit unserem Sprachvermögen erreicht haben.
Wo viel gesprochen wird von vielen Menschen, kann es auch zu Verwirrungen kommen. So bezeichnet das Wort „Pfannkuchen“ unterschiedliche Dinge. Ein Pfannkuchen ist für viele schlicht ein Eierkuchen, flach in einer Pfanne ausgebacken. Für andere ist ein Pfannkuchen ein rundes Gebäck, schwimmend im heißen Fett ausgebacken – mit einem verstecktem Klecks Marmelade im Inneren.
Kräppelchen und Mutzen, Pflaumen und Zwetschgen können ebenso für sprachliche Verwirrung sorgen wie Raben und Krähen, Gimpel und Dompfaff, Sumpfbiber und Biberratte, Löwenzahn und Kuhblume usw. usf. Unsere menschlichen Sprachen sind verwirrend, vielfältig, unterscheiden sich regional und verändern sich zeitlich. So ist in alten Texten über Wälder oft von Schießbeeren zu lesen, die es auch im Leipziger Auwald zahlreich gegeben haben soll, doch welche Pflanze ist dies heute? In Johann Christoph Adelungs Grammatisch-kritischem Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart von 1774–1786 findet man die Erklärung: Schießbeere bedeutet auch Scheißbeere. Im 18. und 19. Jahrhundert bezeichnete man mit diesem deftigen Namen nicht nur eine Pflanze, sondern schlicht alle Sträucher mit Früchten, die nicht bekömmlich waren. Dazu zählen: Kreuzdorn, Faulbaum, Hartriegel, Heckenkirsche, Wolliger Schneeball, Gewöhnlicher Schneeball, Bittersüßer Nachtschatten und Gewöhnliche Traubenkirsche (U.a. solche Sträucher wachsen übrigens bevorzugt in Hudewäldern, kommen aber auch in Auwäldern vor – in welchen aber (und hier schließt sich ein Kreis!) schon immer Weidetiere lebten).
Auch unsere Bäume haben schon viele Namen getragen im Laufe der Jahrhunderte: So bspw. die Esche. Die Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) hatte besonders viele Trivialnamen: Aerschen, Aeschach, Aeschern, Asca, Asch, Ask, Eesch, Ehsse, Eisch, Eschelterpaum, Eske, Espe, Estken, Fladerbaum, Fliegenbaum, Früssen, Geissbaum, Langespe, Wundbaum – diese Liste ließe sich noch weiter fortführen. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass in historischen Texten über die Leipziger Aue vor dem 19. Jahrhundert oft die Rede ist von Aspen, aber Eschen als solche vorher nie genannt werden. Dies kann mehreres bedeuten: einerseits war die Leipziger Aue durch die frei fließenden Flüsse viel öfter überflutet, die Waldlebensgemeinschaft war dementsprechend teilweise ganz anders als heute und es gab so weitaus mehr Weiden, Pappeln und Erlen – hier würden auch Espen (Populus Tremula) passen, welche man auch Aspen nennt. Doch es erscheint uns kaum möglich, dass es hier in dieser Zeit so gar keine Eschen gegeben haben sollte. Die Esche hat Pioniereigenschaften und sie kann, bei aller Bevorzugung bindiger, tiefgründiger Böden auch auf frischen Aueninseln gedeihen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Esche in alten Texten mitunter als Aspe bezeichnet worden ist. Was wirklich wo gemeint war, Espe-Aspe oder Esche, ist rückwirkend schwer festzustellen. Zumindest im sächsischen Hügel- und unterem Bergland (an den Hängen von Talauen) wird u.a. die Esche schon seit der Mittleren Wärmezeit (5800 – 4000 v. Chr.) als Teil der dort vorkommenden Eichenmischwälder genannt.
Man könnte nun denken, wenn wir über Wald allgemein reden, wäre dies vielleicht doch etwas eindeutiger – aber nein! Wald kann viele Bedeutungen haben, hat viele Definitionen und es gibt wahrscheinlich auch zudem in der Tat endlos viele Erscheinungsformen von Wald. Wo fängt Wald natürlicherweise an? Und wie? Wo hört er auf? Und – was ist natürlicherweise? Wissen wir überhaupt, was natürlicherweise ist? Wo wir bei dem Begriff „Natur“ sind – was ist denn Natur überhaupt? Oder gar „Umwelt“ (und wir erinnern an den Unterschied zum Begriff “Umgebung”). Auch diese Begriffe sind irgendwann entstanden, haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich, und allein über „Natur“,„Umwelt“ und „Umgebung“ (in Bezug auf ihre Entstehungen und Bedeutungen im Wandel der Zeit) – mag man ganze Bücher füllen können und hat dies teilweise auch schon getan.Vom Sprachlichen her bedeutet Wald heute laut Duden „größere, dicht mit Bäumen bestandene Fläche“, die Wortherkunft aber geht zurück auf das alt- und mittelhochdeutsche „walt“, welches einerseits einfach mit „nicht bebautem Land“ übersetzt wird, aber – zumindest vom Duden-Blickwinkel betrachtet – auch eventuell mit dem lateinischen „vellere“ für „rupfen, zupfen, raufen, also eigentlich = gerupftes Laub“ verwandt sein könnte (gerupftes Laub, welches man als Futter für das Vieh verwendete). Eine weitere Wurzel könnte aber auch das germanische „*walþu“ sein, welches in seinen vielen Varianten laut Köbler mit folgenden vielfältigen Dingen in Zusammenhang gebracht wird: Wald, Wildnis, Heide, Haar, Wolle, Gras, Ähre, Ebene, Feld, Wiese, Gehölz, Busch, Baumwipfel, Wüste, Einöde, Waldgebirge, Baumbestand, Waldhöhle usw. usf. Sicher ließe sich dies noch weiter fortführen. Frans Vera, ein niederländischer Biologe und Naturschützer, welcher an der Entwicklung des Naturentwicklungsgebietes Oostvaardersplassen beteiligt war und zu Weidetieren als auch Waldgeschichte forscht, hat aus mittelalterlichen Quellen ebenfalls diverse Bedeutungen zum Wort „Wald“ gefunden. Wald war so teilweise schlicht das Gebiet, in dem das Vieh weidete und man Nahrung für die Bienen fand, ein Ort, an dem man Holz sammelte, Blumen pflückte, Heu machte etc. Im Wald war oft viel los! Ernst Schubert schreibt in seinem Buch „Alltag im Mittelalter“, dass es schwer war für Liebespaare, einen ruhigen Platz für ein Stelldichein zu finden, und auch der Wald bot keine Zuflucht: stets und ständig wurde man gestört, und es gab sogar ein warnendes Sprichwort: „Das feld hat augen, die winckel und wäld ohrn.“.
Wald stand also in historischer Zeit u.a. auch im engen Zusammenhang mit „Weide“. Laut Duden lässt sich „Weide“ auf das mittel- und althochdeutsche „weida“ zurück führen: „eigentlich = Nahrungssuche, Jagd“. Weiter geht „weida“ auf das germanische „*waiþī” zurück und steht dort im Zusammenhang mit Jagd, Weide, Futter, Genuss, Streben, Reise, Verfolgung, Speise, Nahrungserwerb usw. usf. Mögen hier zwei sich im Laufe der Geschichte einzeln wandelnde Begriffe zusammen gefunden und sich dann wieder getrennt haben in den heutigen modernen Zeiten? Eines ist gewiss: weder Wald noch Weide sind im Laufe der Zeiten eindeutig und sie sind es auch heute noch nicht. Ihre sprachlichen Deutungen sind vielfältig. Aus den alten Quellen scheint ein gemeinsames Wesen durch, in welchem die beiden Begriffe vermutlich die tatsächlich vielfältigen (sich vielleicht gar überlappenden) Erscheinungsformen von Wald und Weide widerspiegeln. Dies könnte auch die Untrennbarkeit des Auftretens der großen pflanzlichen Lebensformen, der Bäume und der großen tierischen Lebensformen, der großen Weidetiere, bedeuten. Und sowohl aus den geschichtlichen Rückblicken als auch aus unserer heutigen Sicht erkennen wir, wie weitgehend der Mensch in dieses Duo passt, und wie die Natur uns zeigt, wie wichtig es ist, dass wir darin angemessene Positionen einnehmen.
Bedeutungen und Konnotierungen haben sich im Kontext von Zeit, menschlichen Lebensweisen, Bevölkerungsdichten, Bewirtschaftungsformen, Wirtschaftsmodellen, technischen Entwicklungen und wahrscheinlich noch mehr Faktoren geändert. Vieles weiß man schlicht nicht mehr, kann nur vermuten. Man hat, wenn überhaupt, oft nur ungenaue historische Quellen und es lassen sich auch stets viele Widersprüche finden. Eines scheint jedoch gewiss: in der Geschichte unserer Landschaften verlief letztlich doch vieles weitaus regionaler, vielfältiger, bunter und kleinteiliger als heute – und das noch bis in die 1950er-1960er Jahre! Von dieser Kleinteiligkeit der Landschaft und der “ökologischen Organisationseinheiten” durch die gesamte nacheiszeitliche Epoche bis vor gut einem Jahrhundert ist unsere heute auffindbare Biodiversität noch immer geprägt. Waldlebensgemeinschaften (so wie aber auch alle anderen Naturräume) sollten deshalb stets individuell betrachtet werden – auf kleinem Raum können schon große Unterschiede bestehen, und wir sollen solche erhalten bzw. wieder ermöglichen! Wie Wälder bspw. zu einer bestimmten Zeit in Frankreich aussahen und wie sie bewirtschaftet wurden, mag ganz anders bspw. in den ostelbischen Gebieten gewesen sein (zu denen man lange Zeit auch das Leipziger Land zählte, war es doch einst Teil des historischen „Osterlandes“). Nicht nur klimatisch und vom Boden her, sondern auch kulturell, wirtschaftlich und politisch waren die „neuen Länder“ des Mittelalters ganz anders als weiter westlich gelegene Regionen.
Was wir als Wald wahrnehmen, ist also etwas höchst Fluides, so scheint es in der Vergangenheit auch schon gewesen zu sein, so ist es noch heute – aktuelle öffentliche Diskussionen zeigen es ja. Doch wir nehmen Wald nicht nur fluide wahr, Wälder sind von Natur aus (im Sinne „vom Wesen her“) in ihrem Erscheinungsbild fluide, ja müssen es vielleicht auch sein, um überleben zu können. Umwelteinflüsse können auf verhältnismäßig kleinstem Raum schon unterschiedlich sein, ebenso wie der Erdboden. Bäume und Baumgruppen innerhalb einer Waldlebensgemeinschaft haben unterschiedliche Lebensalter, existieren also auch auf unterschiedlichen Entwicklungsebenen, werden aus sich selbst heraus Umwelteinfluss für die begleitenden und nachfolgenden Lebewesen, selbst über ihren eigenen Tod als Baumindividuum hinaus: in einem toten Altbaum können zeitweilig mindestens so viel Kleinlebewesen siedeln, als zu seinen Lebzeiten. Genauso wie Waldlebensgemeinschaften innerlich fluide sind, sind sie es auch nach außen. Folgerichtig heißt es bei vielen Umwelthistorikern, die Grenzen der Wälder wären früher fließend, weicher gewesen als heute. Der harte Bruch kam erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts und wurde erneut stark ab Mitte des 20. Jahrhunderts weiter geführt, er ist also recht neu. Wälder lagen in Mantel- und Saumgesellschaften wie eingebettet (Dierschke) und sie gingen mosaikreich in Heckenlandschaften über, welche in das Offenland ragten. Hecken und Bäume sowie kleine Waldgruppen durchzogen die Landschaft und strukturierten sie reich, höchst “natürlich” begleitet von der uns noch bekannten europäischen Artenvielfalt – und an anderer Stelle ging dieses offene Mosaik wieder weich in Wald über. Wir finden solche Zusammenhänge der Strukturen auch in natürlichem Wald-Weideland bis heute u.a. in Afrika, wo eine reichhaltige Großtierfauna im Wechselspiel mit der Vegetation wirken kann. Von Menschen aus der Landschaft heraus gestaltete Hecken haben also ihre Ursprünge oder Vorbilder in einer nicht von Menschen, sondern von Weidetier und Vegetation gestalteten Natur! „Eine Hecke zieht Tiere an wie ein Magnet, sie ist der Finger an der Hand des Waldes“ sagte einst Hermann Benjes. Mögen sie vielleicht Finger sein von Händen, die sich gegenseitig berühren, verbinden – ja, biotopvernetzende Strukturen sein, die nun viel zu oft fehlen? Mag es auch vielleicht im Wesen der Wälder, ja, der gesamten Landschaft liegen, genau wie die Flüsse und Bäche und Küsten in gewissem Rahmen auch dynamisch zu sein? Flüsse brauchen Dynamik, um reines Wasser zu behalten und sich selbst reinigen zu können, von wo es noch reiner werdend in den Boden versickert, um in den Tiefen reinstes Quellwasser zu werden. Es ist nachvollziehbar, dass auch die eng an Flüsse angebundenen Auen diese Dynamik brauchen. Es ist aber ebenso möglich, dass Wälder auch ohne Flüsse, ja, Elemente unserer Landschaft generell, Dynamik brauchen und auch dynamisch sein müssen. Mag es sein, dass sie alle an den Rändern beweglich sein müssten, um sich von ihrem Wesen her aus sich selbst (weiter) entwickeln, entfalten zu können? Vieles deutet darauf hin, und diese Fluidität von Wäldern, ja ganzen Landschaften, hängt auch zusammen mit dem Einfluss der Tiere in ihrer ganzen Vielfalt, Tiere, die selbstverständlich zu einer Waldlebensgemeinschaft und generell den Landschaften, ja, in die ganze Umwelt gehören. Dazu zählen auch Tiere, die uns unbequem erscheinen mögen, wenn wir sie frei leben lassen, was wir vielleicht aber tun sollten, wo es möglich ist – denn mögen sie nicht eine Funktion in der Natur haben, aus der sie sie sich ja auch entwickelt haben? Kann Natur je anders sein, als dynamisch in Raum und Zeit?

Maisacker im FFH-Gebiet “Leipziger Auensystem” im Sommer 2019 nahe der Domholzschänke. Foto: J. Hansmann
In dieser sich stets und ständig ändernden Umwelt leben nun wir Menschen – und in Europa sind wir nördlich der Alpen und südlich der nördlichen Kalt-Lebensräume seit dem Ende der Eiszeit wirksam präsent. Wir versuchen, schriftlich etwas festzuhalten, aus praktischen Gesichtspunkten des alltäglichen Umgangs, als auch, um etwas zu hinterlassen. Und die uns nachfolgenden Menschen interpretieren dieses aus den Blickwinkeln ihrer Zeit mit ihrem neuen Hintergrund. Historische Texte und Informationen wurden schon in der Vergangenheit mehrfach aufgegriffen und neu überdacht, ein Mensch des frühen 20. Jahrhunderts schreibt über einen Text aus dem 16. Jahrhundert, er schreibt, dieses und jenes wäre vielleicht so gewesen, und zu Beginn des 21. Jahrhunderts wird dies von den Rezipienten als Tatsache genommen. Dabei wird anderes, was ebenso schriftlich bezeugt ist – nicht nur im Konjunktiv – und welches auch ablesbar ist an Strukturen von Landschaft, im weiteren Verlauf der Geschichte manchmal weggelassen, wird zur Nebensache. Warum? Weil wir sehr menschlich mit sehr begrenztem zeitlichen Horizont die Archive interpretieren, und manches auch einfach im Vergangenen so gehabt haben wollen (!). Wir wollen edle Ritter sehen, aber wie oft oder ob überhaupt es diese edlen Ritter so je gab, ist zweifelhaft. Und natürlich sind einfache Lösungen und Antworten attraktiv, sie mögen sogar auf den ersten Blick logisch erscheinen – und es wird verständlich, denn sie gehen gut rein in die Köpfe hinein und “begründen” etwas ggfs. Gewünschtes. Aber auf den zweiten Blick offenbart sich, dass weder Natur noch Geschichte derart einfach gestrickt waren und sind – beide verhalten sich weitaus komplexer, vielschichtiger. Geschehenes wird überliefert, verarbeitet, neu aufgeschrieben und dabei dem Zeitgeist folgend wechselnd eingefärbt, manchmal bis zur Unkenntlichkeit. Und Wald, ja, man möchte fast sagen, Natur generell, scheint zudem in sich derart dynamisch zu sein, fließend, vom Wesen her in sich aufgeteilt in viele lokale einzelne Bestandteile, strukturreich und artenreich, wie ein Mosaik, ja, fast schon ein Kaleidoskop, welches von jedem Punkt anders aussieht, von dem man es betrachtet, und welches sich wiederum jederzeit unvorhersehbar ändern kann, wenn bspw. ein Sturm oder eine Flut es zu schütteln beginnt. Menschen konnten verständlicherweise also stets nur einen Moment und einen Aspekt beschreiben, nie das Ganze, und wir können dies auch heute nur so tun, weil die Systeme zu komplex sind und unsere Naturforschung teilweise noch sehr am Anfang ist – von vermeintlichen Sachzwängen einmal abgesehen, die die Blicke der Forschung in möglicherweise auch unrelevante Winkel ab-lenken.
Doch was passiert mit einer solchen lebendigen, dynamischen, fließenden Naturwelt, wenn man sie künstlich starr einteilt in Bereiche, die Grenzen fest und hart macht, verbindende und sich verschränkende Finger abhackt? Wenn man weich sich verzweigende oder mäandernde Ufer betoniert und fließendes Wasser mit Stein und Metall zur Gleichförmigkeit reguliert und korsettiert, und wenn man dabei Pflanze-Tier-Gemeinschaften mit Maschinenkraft monotonisiert? Wie soll eine Landschaft, ein Fluss, eine Waldlebensgemeinschaft auf lange Sicht so existieren können, sich an natürlich resp. anthropogen wechselndes Klima einstellen oder langzeitlich sich sogar anpassen können? Können da konservierende Maßnahmen auf kleinstem Raum helfen, wenn es zudem noch vielleicht die falschen sind, vielleicht auch mit falschen Mitteln begonnen – oder vielleicht auch falsch konzipiert, da wichtige Rahmenbedingungen unbeachtet blieben? Vielleicht bewirken sie auch das Gegenteil, wollen “Gutes” tun, aber könnten Gegenteiliges zur Wirkung haben. Es ist an der Zeit, hier dringend weiter zu denken, bevor man fortfährt mit der Musealisierung der Natur in kleinen Reservaten – Schaukästen, Dioramen gleich.
Es gilt weiter zu denken, bevor man flächendeckend weiter macht, deutschlandweit, europaweit, weltweit. Und lokal gesehen, mit Leipzig im Blick: was ist dies, ein „Auwald“ ohne frei ziehendes Wasser? Was kann ein Auwald noch sein, ohne größere Tiere, mit modernen technischen Mitteln nachgebaut nach dem Modell einer vorgeblich uralten Waldbewirtschaftungsmethode, von der es Anfang des 20. Jahrhunderts hieß, es könnte sie im Leipziger Auwald so gegeben haben, man ginge davon aus? Belegt ist dies nicht, und es ist am heutigen Walde auch nicht mehr erkennbar. Wenn es diese Waldbewirtschaftung je gab, hat sie keine sicher fassbaren Spuren hinterlassen, was seltsam erscheint, doch vielleicht vermuten wir solche Spuren auch schlicht am falschen Ort. Etwas, was aber keine Spuren hinterlassen hat, vielleicht nie da war (oder nicht dort, wo wir denken), und wenn, jedenfalls nicht sehr lange, d.h. nicht einmal eine halbe Eichengeneration, mag auch nicht relevant sein für das, was wir hier und heute an schützenswertem Lebendigen vorfinden! Das Diorama, das mit Motorsägen und viel Abgas aufgebaut wird, bleibt ein künstliches Diorama. Das langsam strömende, frei ziehende Wasser der Flüsse fehlt, das, was eine Aue wesentlich ausmacht. Vielleicht wird man das Wasser eines Tages mit Stoffbahnen imitieren, ein paar Kühe aus Plastik aufstellen und einen mittelalterlichen Holzhauer aus dem 3-D-Drucker dazu? Ist dies das Ziel des Naturschutzes? Und dann weiterhin das Gras und die aufkommende Naturverjüngung des Waldes mit motorbetriebenen Geräten und viel Abgas vormittags mähen, wenn das Museum gerade nicht so stark besucht ist, weil Gras und Naturverjüngung unordentlich sind und nicht in das historische Abbild passen?

Roteichenaufforstung im FFH-Gebiet “Leipziger Auensystem” nahe Klein-Liebenau Anfang 2019. Foto: J. Hansmann
Es nimmt nicht Wunder, wenn dann neutrale Menschen aus anderen Regionen bei einer vorweihnachtlichen Wanderung im Winter 2019 durch die Leipziger Aue staunend all die fantastischen Hude-Eichen bemerken, Menschen, die alte Mittelwälder aus anderen Regionen kennen und vom Unterschied wissen. Und auch suchte man wieder nach Mittelwaldrelikten, doch fand keine. Es wurde auch gezielt gesucht, ob ein aus dem derzeitigem Hochwald hier entstehender Mittelwald zu sehen wäre, doch man sah nur Großschirmschlag. Was wir dort sahen, jede BürgerIn ansehen kann, es ist und es wird kein Mittelwald, so die Erkenntnis. Was wir sahen, war ein Auwald ohne frei fließenden Fluss, ohne Wasser, das ihn zu mancherlei Zeit – Spuren hinterlassend – langsam durchströmt. Wir sahen einen Auwald mit alten Hude-Eichen, aber ohne jegliche (größeren) Tiere, welche einst dort waren und diesen Wald prägten, welche aber in unseren modernen Zeiten ihr ganzes Leben lang in von der Außenwelt fast hermetisch abgeriegelten Ställen stehen. Tiere, die nie das Sonnenlicht sehen, nie den Wind spüren, sich nie wirklich frei bewegen können, Tiere, die nur noch wie Werkzeuge in einer Fabrik mit Fließbändern behandelt werden, vorne Futter rein, hinten Melkmaschine ran oder wenn es soweit ist, aufs Fließband des Schlachthofes, zerteilt dann in die Wurstfabrik, als Aufschnitt dann auf dem Fließband zur Verpackungsstrecke und per LKW auf zum Supermarkt und dort in die Theke. Andere wie der Hirsch werden rigoros bejagt, in Quasi-Reservaten gehalten und an ihren Wanderungen gehindert. Elch und Wisent werden erschossen und überfahren, sobald sie versuchen, zurück in ihre angestammten Reviere zu kehren. Westlich der Oder lauert für sie der Tod, sie werden entweder als Kuriosität oder als Gefahr für die Öffentlichkeit wahrgenommen. Dabei sollte es doch klar sein, dass die (Weide)Tiere in der Natur ihren Sinn hatten und hätten (ebenso wie ihre Beutegreifer). Dort und nur dort könnten sie auch artgerecht ein tiergerechtes Leben führen, so wir es ihnen nur erlaubten. Dass es einem landesüblichen Forstbetrieb oder Amt lieber ist, keine großen Weidetiere in einem Wald zu haben, ist nachvollziehbar, sind deren Wälder doch für diese i.d.R. Holzfabriken mit Managern. Es werden Bäume gepflanzt, von denen man weiß, sie passen gut in die Maschinen des Sägewerks, wachsen schnell, und es werden die Arten gepflanzt, von denen man annimmt, sie würden unter dem erwartetem Klima am besten wachsen, Arten, welche aber oft nicht aus unserer Region sind. Man setzt auf Baumarten wie auf Kugeln in einem Roulette-Spiel.
Wald ist weltweit ein Ort der scheinbar unbegrenzten Investitionsmöglichkeiten geworden. Große Tiere stören und vermindern den Gewinn, wie es auch vom frei fließenden Wasser der überflutbaren echten Auen befürchtet wird. Der motorisierte Straßenverkehr darf nicht aufgehalten werden und die Landwirtschaft will auch weiter in ihrer lebensfeindlichen Agrarwüste Gewinne erwirtschaften. Was stört – Natur – ist ein Ärgernis geworden. Auf „Unkraut“ wird Gift versprüht, widerborstige Problem-Tiere erschossen, Flüsse einbetoniert, und dem Wald rückt man mit Harvestern und Motorsägen zu Leibe, wenn er nicht tut, was Mensch will. Vielleicht ist ja auch der Mensch der Problem-Mensch und nicht der Bär der Problem-Bär?

Mittelwaldversuch in der Leipziger Burgaue im Sommer 2019. Vor allem Ahorn (Bergahorn, Spitzahorn) profitiert sichtbar durch massiven Aufwuchs. Foto: J. Hansmann
Man denkt auch über Energiewälder nach, es mag nicht erstaunen, das Nieder- und Mittelwald wieder im Gespräch sind in vielen Regionen. Nicht umsonst gibt es Schriften wie „Biomasse im Mittelwald – Potenzialabschätzung und Nährstoffnachhaltigkeit“ und auch Projekte wie im Nordrhein-Westfälischen, die seit einigen Jahren probieren, wie gut man Mittelwälder für Energieholz nutzen kann. Die Schweizer Stadt Winterthur kommuniziert dies sogar direkt und ehrlich, dass sie mit ihrem Mittelwald u.a. „den mittelfristigen Mehrbedarf der Stadt Winterthur an Energieholz decken“ will. Nun muss dies im Leipziger Auwald nicht so sein, aber es mag nur verdeutlichen, dass Mittelwälder eben keineswegs nur aus Gründen des Naturschutzes deutschlandweit aktuell in Mode sind, sondern dass dies absolut überwiegend aus wirtschaftlichen Gründen geschieht, und sei es auch nur der Grund, ein altes Modell mit neuen Mitteln in Zeiten auszuprobieren, wo man weltweit über neue, regenerative Energien nachdenkt. Und es mag auch in einem entsprechenden Wald, wo einst wirklich und auch heute noch sichtbar ein solcher Mittelwald war, solches angemessen erscheinen. Es ist durchaus auch eine interessante Idee, solches an einem Waldstück weit verbreiteter Artenzusammensetzung auszuprobieren, doch sollte das nicht in einem Auwald mit international anerkannter ökologischer und Naturschutzqualität geschehen.

Femelloch in der Nonne (Leipziger Auwald) im Sommer 2019 mit nach und nach absterbenden Starkbäumen. Foto: J. Hansmann
In einer Hartholzaue dagegen, die weitaus mehr von Flüssen und deren Wasser, ja, auch von Weidetieren geprägt ist – von denen man im Leipziger Auwald durchaus noch Spuren deutlich sieht – wirken solche experimentellen Projekte wie des Versuchs, einen Mittelwald aus Hochwald zu entwickeln, unwillkürlich wie Fremdkörper, und es wird bizarr, wenn sogar forstlich und ökologisch wertvolle Starkbäume noch für ein solch forstliches Diorama herhalten müssen. Dieses rabiate Vorgehen passt nicht in Zeiten, wo wir über jeden einzelnen dieser Starkbäume froh sein sollten, da wir nicht abschätzen können, wie viele und welche von ihnen in Zukunft überleben werden. Es geht um die Erhaltung des Waldinnenklimas in kommenden Sommern! Wer weiß schon, welche Temperaturen und Niederschlagsmengen uns demnächst erwarten? Wer weiß schon, welcher Baum der dort stehenden die besten genetischen Voraussetzungen für das zukünftige Überleben im neuen Jahrtausend haben wird?
Somit schauen wir ebenso zuversichtlich wie gespannt in das Jahr 2020 und auf die kommenden Wirrungen, die wir mit Sicherheit durch Klima und Wetter sowie Nutzungseingriffe weiter beobachten werden können. Der Wald bleibt unwägbar, auch wenn man ihn planbar machen will, die Bäume bleiben unordentlich und wachsen einfach ungerührt dort, wo sie ihrer Art gemäß am besten wachsen – und wo sie “am besten” wachsen, das muss nicht immer dort sein, wo modern wirtschaftender Mensch es gern hätte! Doch die Lebewesen haben ihre Gründe für Gedeihen oder Krankheit und Absterben, und vielleicht sollte Mensch sich für die Zukunft doch mehr Zeit nehmen zum Zuhören und Erforschen seiner Mitgeschöpfe, anstatt sie mit Baggern, Rasenmähern und Motorsägen maßzuregeln. Natur braucht Raum, den man ihr lassen muss, und es braucht menschliche Geduld, Natur zuzulassen.
Doch der moderne Mensch eilt und hastet und tut. Mit der heißen Nadel vermeintliche Lösungen stricken – kann dies, nach aller Erfahrung, gut sein? Zu solch´ heißer Nadel gehören auch aus dem Boden gestampfte Massenaufforstungen mit Baumschulware angesichts des Klimawandels – auch hier dient Bedachtsamkeit; Hektik oder Panik verwirren und schaden nur.
Es ist durchaus wichtig, etwas zu tun, es mag auch wichtig sein, es bald zu tun, aber es ist vor allem auch wichtig, sich dennoch die Zeit zu nehmen, über das, was man tut, gründlich nachzudenken, vielleicht bei Gelegenheit auch einen Schritt zurück zu tun, innezuhalten und neu zu denken: damit das, was man tut, doch das rechte sei.
Prof. Dr. Bernd Gerken, Ratingen und Graz
Dipl. Des. Johannes Hansmann, Leipzig



![Hendrik Barend Koekkoek [Public domain]](https://www.nukla.de/wp-content/uploads/2020/01/HB_koekkoek_Lanschaft_kl-300x225.jpg)